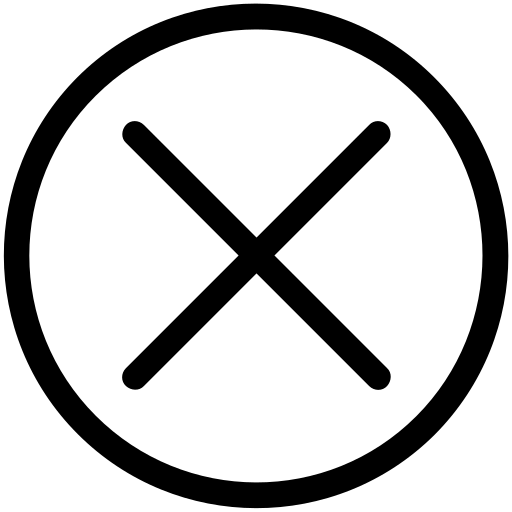Die wichtigsten Trends im Bereich Insolvenz:
– Die Covid-19-Pandemie und deren Folgen stürzte viele Unternehmen in existenzielle Ertrags- und Liquiditätskrisen. Zusätzlich belasteten der Ukraine-Konflikt, Lieferkettenprobleme und der Rohstoffmangel die Situation.
– Zu den aufgrund von Preiserhöhungen und Lieferkettenproblemen besonders betroffenen Sektoren zählen Automotive, Zulieferer, Einzelhandel, Bau und Immobilien sowie Flughäfen und Fluggesellschaften.
– Beratungsbedarf bestand während des Recherchezeitraums daher insbesondere zu vorinsolvenzlichen Themen und der Nutzung öffentlicher Fördermittel sowie von Förderkrediten aus speziellen Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen.
– Gleichzeitig bedingt das wirtschaftliche Umfeld eine Zunahme an Auseinandersetzungen und Anfechtungsklagen sowie ein rückläufiges Gesamtvolumen an Insolvenzverfahren. Asset Deals aus der Insolvenz gewinnen an Bedeutung.
Zu den signifikantesten personellen Veränderungen des Berichtszeitraums zählen der Wechsel des Insolvenzverwalters Torsten Martini von Leonhardt Rattunde im April 2023 zu GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB und der Wechsel von Christian Holzmann (Eigenverwaltung, Sachwaltung und Insolvenz) von CMS zu Brinkmann & Partner im Juli 2023. Auch Grub Brugger PartG mbB verzeichnete mit dem Neuzugang Richard Scholz (Insolvenz, Sanierung und Restrukturierung) von Wellensiek Rechtsanwälte - Partnerschaftsgesellschaft im Januar 2023 Verstärkung. Torsten Cülter (Corporate/M&A, Insolvenzrecht und Prozessführung) wechselte im Oktober 2022 von ADVANT Beiten zu Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
Die wichtigsten Trends im Bereich Restrukturierung:
– Unsicherheit in der politischen und regulatorischen Landschaft sowie steigende Energiekosten, Inflation und Lieferkettenprobleme bedingten Ertrags- und Liquiditätskrisen und den Rückgang von Eigenkapital.
– Besonders von Restrukturierungsszenarien betroffen sind die Automobilbranche, die Immobilien- und Baubranche, der Gesundheitssektor und der Pflegebereich.
– Das StaRUG (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen) stärkt das Eigenverwaltungsrecht und bietet neue Möglichkeiten für Unternehmenssanierungen.
– Der Beratungsbedarf im Kontext finanzieller und operativer Restrukturierungen stieg während des Berichtszeitraums ebenso an wie Refinanzierungen, insbesondere im Immobilienbereich. Zudem nahmen M&A-Deals im Distressed-Umfeld und Konsolidierungstransaktionen zu.
Zu den signifikantesten personellen Veränderungen des Berichtszeitraums zählen der Wechsel von Cristina Weidner (finanzielle Restrukturierungen) von Clifford Chance zu Kirkland & Ellis International LLP, der Wechsel von Josef Parzinger (Bank- und Finanzrecht, Restrukturierung) von Kirkland & Ellis International LLP im Januar 2023 zu A&O Shearman und der Wechsel von Boris Ober (außergerichtliche und insolvenzrechtliche Restrukturierung) im Juli 2022 von Reitze Wilken Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB zu Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Zudem wechselte das Team um Frank Schwem, Torsten Pokropp (beide unter anderem Restrukturierungsberatung, Refinanzierungen), Christian Lonquich (Transaktions- und Asset Management als auch Finanzierung und Restrukturierung), Mike Danielewsky (Restrukturierung und Sanierung in- und außerhalb von Insolvenzverfahren) und Martin Wilmsen (Kreditfinanzierungen, Refinanzierungen) im Juli 2022 von DLA Piper zu Bryan Cave Leighton Paisner. Hans Beyer (Restrukturierungen, Insolvenz) verließ im Januar 2023 K&L Gates und stieg bei Dentons ein, während Lukas Herbert (Distressed M&A, Insolvenzverfahren) die Kanzlei im September 2023 verließ und zu Grub Brugger wechselte.